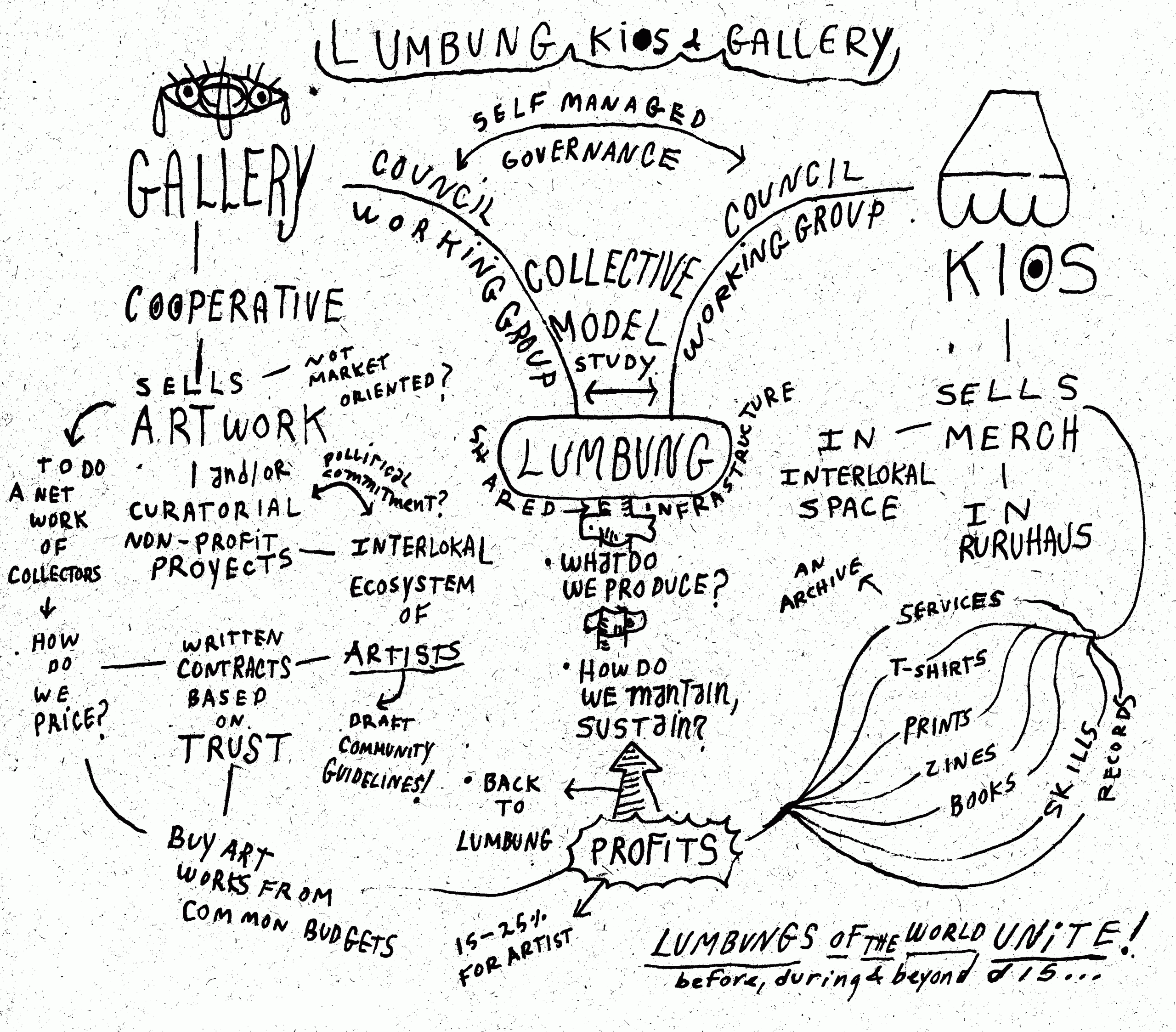„People’s Justice“. Mittlerweile dürfte jedes Schulkind das Banner der indonesischen Künstler:innen-Gruppe Taring Padi kennen, welches beinahe die documenta fifteen (d15) zu Fall gebracht hätte. Das abgehängte Werk steht jetzt wie ein Symbolbild für den globalen Antisemitismus. Dabei ist die Ikonographie der zwanzig Jahre alten Arbeit komplexer.
Öffnet es doch, trotz der Schläfenlocken, Schweinsgesichter und SS-Runen, gleichsam wie ein Zeitfenster den Blick in eine Schlüsselszene der postkolonialen Geschichte Indonesiens Ende der 1990er Jahre: den Kampf gegen den Diktator Suharto, der von den Geheimdiensten der früheren europäischen Kolonialmächte unterstützt wurde.
Kulturwissenschaftler:innen werten die dabei verwendeten, unbezweifelbar antisemitischen Bildmotive freilich als eine Spätfolge des Kolonialismus. Mit diesem kulturellen Export rassistischer Stereotype suchten Kolonialmächte wie die Niederlande und Deutschland ab dem Beginn des 19. Jahrhunderts die dortigen Bevölkerungsgruppen gegeneinander auszuspielen.
So diffundierten sie auch in das oppositionelle Bildvokabular. Es wird sich zeigen, ob die documenta, trotz der publizistischen Hysterie um den angeblich intrinsischen Antisemitismus einiger ihrer Teilnehmer:innen, den Mut findet, diesen piktorialen Wanderbewegungen wenigstens versuchsweise nachzugehen. Wo, wenn nicht auf einer Weltausstellung der Kunst sollte eine derartige Analyse stattfinden?
Die Idee des Anti- und Postkolonialen ist jedenfalls ein inneres Verbindungsglied zwischen den beiden Ausstellungen, die das überbordende Kunstjahr 2022 prägen.

Wobei die Berlin-Biennale trotz des Überaufgebots an Dokumentarvideos und -diagrammen auch Positionen bietet, die das Politisch-Aktivistische mit einem so verpönten Begriff wie Schönheit verbinden: Wie Mónica de Mirandas ästhetisch bezwingender Film „O caminho das Estrelas“ über die Rolle der Frauen im Befreiungskampf in Angola etwa.
Demgegenüber setzt die d15 keineswegs auf den oft beklagten Verzicht auf Ästhetik, aber doch eher auf eine Do-It-Yourself oder Hybrid-Ästhetik, man könnte auch sagen: auf einen offenen Werkbegriff. In Abwandlung des berühmten Clausewitz-Zitates über den Krieg ließe sich die d15 als „Fortsetzung des politischen Verkehrs unter Einmischung künstlerischer Mittel“ bezeichnen.
Doch wenn etwas die beiden Großausstellungen grundlegend unterscheidet, dann ist es weniger deren (partiell identischer) Inhalt, sondern deren Struktur. In Berlin gibt es den einen zentralen Kurator namens Kader Attia. Der französisch-algerische Künstler definiert seine Arbeit zwar als „Reflexion im Dialog“. Die Mitglieder seines künstlerischen Teams sollen jedoch, wie er betonte, „meine Recherchen vertiefen“.
Im Kern geht es Attia darum, die „Verletzungen“ des Kolonialismus mit großem Nachdruck herauszustellen. So nachdrücklich, so sehr mit einer Ästhetik des Schocks, dass das Trommelfeuer der Anklagen vom Raub der Adivasi-Überreste in Sri Lanka durch europäische Museen bis zu den „Verletzungen“ des libanesischen Luftraums durch die israelische Luftwaffe zu einer tendenziellen Überforderung der Betrachter:innen führt, die ständig das Gefühl haben, einen Lehrpfad wie im Oberstufen-Leistungskurs Internationale Sozialkunde absolvieren zu müssen.
Wobei sich Attia, das nur nebenbei gesagt, mit seinem Beharren auf der Idee des „Sichtbarmachens des Unsichtbaren“ (hier: der nach wie vor bestehenden Präsenz kolonialer Strukturen und Dispositive, daher der Titel „Still Present!) dem Urheber dieser Semantik annähert, Paul Klee nämlich, einen Heroen der mittlerweile unter Gewaltverdacht stehenden (West-)Moderne also.
Die d15 dagegen ist nicht nur, ausweislich ihres „Lumbung“-Titels, ein Experiment in praktizierter Solidarität, das den postkolonialen Rahmen überschreitet. Statt der strengen Didaktik der Berlin Biennale kommt sie spielerisch, offen, inklusiv und prozesshaft daher.
Ein Experiment, das unter dem Druck der Krisen, Pandemie, Ökologie und den Krieg in der Ukraine, an Bedeutung über den Kunstbetrieb und -diskurs hinaus gewinnt. Mitsamt dem Versuch, das in den letzten Jahren unter Legitimationsdruck geratene System des Marktes über die Einrichtung der „Lumbung-Gallery“ vom kommerziellen Kopf auf die gemeinwirtschaftlichen Füße zu stellen.
In allererster Linie ist die d15 aber ein großes Experiment in der Delegation von Autorität. Die Kurator:innen um ruangrupa haben ihr (Macht-)Privileg der Einladung von Künstler:innen zu einem Großteil abgetreten, konnten doch diese in „majelis“ organisierten Kollektiv-Verbünde über ihre Struktur, die Teilnehmer und die ausgestellten Werke und sogar über die Verwendung der finanziellen Ressourcen in Eigenregie bestimmen.
So wirkt dieses Prinzip einer dezentralen, autonom sich entfaltenden Organisation mit „Budgetrecht“, ohne es aufdringlich zu thematisieren, wie eine Reaktion auf die in den letzten Jahren neu aufgebrochene Frage nach Macht und Privilegien im Kunstbetrieb. Insofern folgen, neben allen inhaltlichen Fragen zu Kolonialismus, Postkolonialismus und dem berühmten „Globalen Süden“ die Macher der d15 einer Idee des kalkulierten kuratorischen Kontrollverlusts.
Der Kollateralschaden, der bei diesem Prinzip in Gestalt des antisemitisch infizierten Banners „People’s Justice“ und nun auch noch einer womöglich ähnlich kontaminierten Broschüre aus den „Archives des Luttes des femmes en Algérie“ eingetreten ist und den Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur Eröffnung der Schau mit seinem Wort “Verantwortung lässt sich nicht outsourcen“ bedachte, wird künftig als Hypothek das Prinzip des (kollektiven) Kuratierens insgesamt überschatten. Stoff für mehr als ein documenta-Symposium.