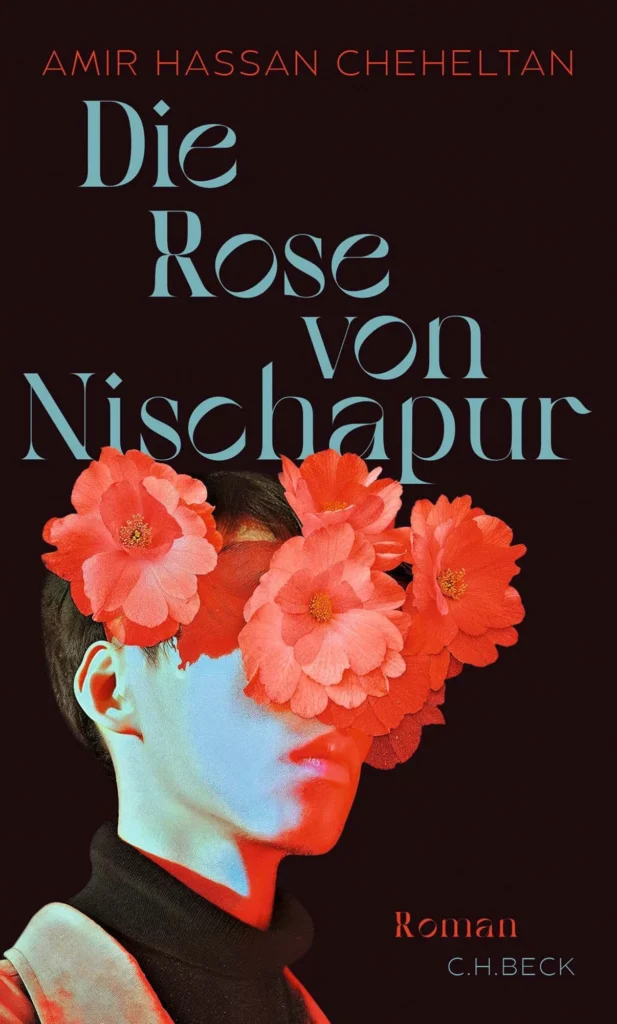Ein großes B, ein kleines m, ein umgedrehtes X, auf einen dreieckigen Marmorsockel getürmt. Bei „Angels of Alphabet“, der großen Skulptur am Eingang des Museums Feshane verstehen die Besucher:innen rasch, worum es geht.
Ahmet Güneştekin, der Schöpfer der menschenhohen Installation aus rostigen Buchstaben in der alten Fez-Fabrik in Istanbuls Stadtteil Eyüp am Goldenen Horn, will damit an die Sprachen erinnern, die in der Türkei seit ihrer Gründung 1923 verboten wurden. „Lost Alphabet“ hat er seine riesige Retrospektive deshalb genannt.
Der Künstler, Jahrgang 1966, geboren in der multikulturellen Stadt Batman im kurdischen Teil der Türkei, ist das faszinierende Paradebeispiel eines erfolgreichen Außenseiters.
Der Autodidakt, der nie eine Kunstschule besuchte, markiert ein aufschlussreiches Schisma zwischen der kritischen Kunst der Türkei, die die globale Kunstwelt in den letzten zwanzig Jahren eroberte und ihrer populären Variante.
Die Legende will es, dass Güneştekin schon im zarten Alter von sechs Jahren das erste Gemälde geschaffen haben will und mit 16 Jahren seine erste Ausstellung absolvierte.
Inzwischen hat er sich auf großformatige, farbenfrohe Installationen spezialisiert. Das Werk „Atlas of Legends“, welches im Museum Feshane zu sehen ist, ist viereinhalb Meter lang und knapp zwei Meter hoch.
In die 28 tiefblau lackierten Boxen, aus denen sie besteht, sind knallbunte Rechtecke und florale Ornamente integriert. Leicht abstrahiert nehmen sie anatolische Mythen und deren Muster auf.
Das kunstgewerblich Perfekte, nah am Massengeschmack Gebaute solcher Arbeiten mag ein Grund für die erstaunliche Karriere des Künstlers sein.
Güneştekin ist damit in den letzten Jahrzehnten so erfolgreich geworden, dass er eine eigene Stiftung gründen konnte. Mit ihr vermarktet der Selfmademan sein Werk, fördert aber auch den Nachwuchs.
Gerade hat er sich den Palazzo Gradenigo in Venedig gekauft. Zusammen mit einer Dependance im westtürkischen Urla firmiert dieser Komplex nun unter dem Label „Güneştekin ArtRefinery“.
Mit 1,3 Millionen Followern auf seinem Instagram-Kanal erreicht dieser Mann zudem ein Massenpublikum, von dem die kritische Gegenwartskunst der Türkei nur träumen kann.
Es ist Güneştekins Hang zum pathetischen, überdimensionierten Blockbustertum, der diese Szene Abstand halten lässt. Seine „Chamber of Immortality“ etwa besteht aus 11000 handgefertigten, glitzernden Totenköpfen.
Güneştekin schöpft aus dem folkloristischen Formenvokabular seiner kurdischen Heimat. Im neuen Luxushafen Galataport steht direkt neben dem privaten Kunstmuseum Istanbul Modern ein Werk aus seiner “Kostantiniye“-Serie: In Form des kurdischen Sonnenrades erinnert es an die vielen Namen der türkischen Metropole seit ihrer Gründung vor knapp 3000 Jahren.

Das heißt nicht, dass seine Arbeit ohne kritische Intentionen wäre. „Lost Alphabet“-Kurator Christoph Tannert, lange Direktor des Berliner Künstlerhauses Bethanien, erinnert an „all die Verwerfungen, eingeschlossen den Schmerz in der multikulturellen türkischen Gesellschaft und der kurdischen Community“ in Güneştekins Werk.
Als markantes Beispiel dafür ließe sich die Arbeit „Disappeared Language“ heranziehen. Eine Wand der riesigen, alten Ausstellungshalle ist mit knallbunten Straßenschildern behängt.
Auf ihnen sind nicht die Namen verdienter Politiker:innen zu lesen, sondern diejenigen der Menschen, die seit den neunziger Jahren in türkischer Haft verschwanden und nie wieder gesehen wurden oder ermordet wurden wie 2007 der armenische Journalist Hrant Dink.
Güneştekins Werk verkörpert paradigmatische das Dilemma politischer Pop-Art: Seine kritischen Ideen stehen in einer reziproken Relation zu der gefälligen Umsetzung. Innere Brüche sucht man darin vergebens. Er ist so bunt, dass er die Kritik gleichsam in eine Ware verwandelt.
Als Güneştekin 2021 im kurdischen Diyarbakır in seiner Ausstellung „Erinnerungsraum“ 34 bunt gestrichene Särge in einem Festungsturm der Stadtmauer platzierte, um an die Zivilist:innen zu erinnern, die bei einem Feldzug der türkische Armee gegen die Kurd:innen zehn Jahre zuvor getötet worden waren, wetterte der türkische Innenminister gegen den Künstler. Die Hinterbliebenen der Opfer dagegen sahen deren Andenken verhöhnt.
Gegen das in der Istanbuler Kunstszene verbreitete Unbehagen an Güneştekins dichtem Netzwerk aus Netzwerk aus Prominenten, vermögenden Sammler:innen und Industriellen wehrt sich der Künstler oft mit dem Argument, er sei „kein Staatskünstler“.

Der distanzlose Schulterschluss mit Ekrem İmamoğlu, Istanbuls Oberbürgermeister von der oppositionellen CH-Partei, bei der Eröffnung der Schau widersprach freilich diesem Rollenverständnis. Auch wenn er riskant war, so wie sich Präsident Erdoğan derzeit auf seinen mutmaßlichen Präsidentschaftsrivalen einschießt.
Die Freundschaft mit dem charismatischen, kulturaffinen İmamoğlu, die Güneştekin überschwänglich betonte, mag auch der Grund dafür gewesen sein, dass er im Museum Feshane ausstellen konnte.
Die vor anderthalb Jahren eröffnete Kunsthalle hatte İmamoğlu als eine von mehr als 40 neue Kulturstätten in Istanbul dem Ziel schaffen lassen, das kulturelle Erbe zu erhalten und eine Art „Kultur-für-alle-Politik“ al la turquoise zu etablieren,
Die neuen Häuser, alle mit Bibliotheken ausgestattet, stehen oft in bildungsfernen, konservativen Stadtteilen. Bei der Eröffnung 2023 kam es zum Eklat, als einige, queerverdächtige und freizügige der rund 300 Arbeiten von Besucherinnen vandalisiert worden waren.
Womöglich deswegen hat İmamoğlus Stadtverwaltung für die jüngste Schau einen Künstler ausgewählt, der zwar auf seine Weise auch politisch ist, wegen seiner frohen Formensprache aber nicht direkt aneckt.
Es wird sich zeigen, ob es diesem Oeuvre gelingen wird, dem Ziel näher zu kommen, welches der Oberbürgermeister bei seiner Ansprache mit dem, für türkische Verhältnisse durchaus mutigen Slogan beschwor: „Das freie Denken“.
Ahmet Güneştekin: Lost Alphabet. ArtIstanbul Festhane. Istanbul-Eyüpsultan. Noch bis zum 20. Juli 2025. Katalog: 40 Euro