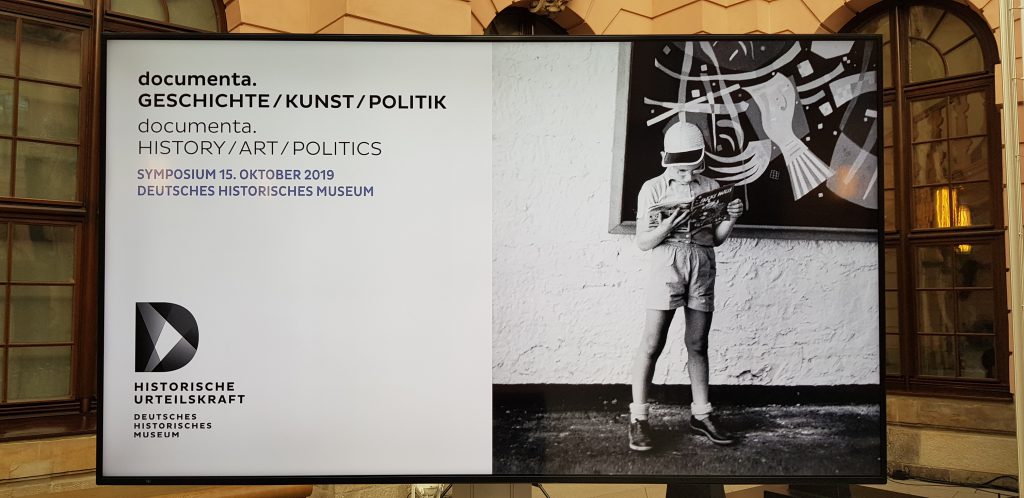
Eine Ausstellung über die Geschichte der documenta. Als Raphael Gross, der frischgebackene Direktor des Deutschen Historischen Museums (DHM), Ende 2017 ankündigte, eine Ausstellung über die Geschichte der documenta veranstalten zu wollen, ging das noch im allgemeinen Betriebsrauschen unter. Die Begründung des Schweizer Historikers und ehemaligen Direktors des Jüdischen Museums in Frankfurt damals klang freilich so naheliegend, dass man sich wunderte, warum der Kunstbetrieb nicht selbst darauf gekommen war.
Schließlich sei die documenta, so Gross in einem Gespräch, eine Schau, die in Deutschland zu einer Zeit entstanden sei, wo man versuchte, „sich neu zu orientieren in der Welt gegenüber Kaltem Krieg, gegenüber der sozialistischen Kunst, gegenüber der ‚Entarteten Kunst‘-Verdammung durch den Nationalsozialismus“. Welche Sprengkraft der Plan entwickeln sollte, zeigt sich dann knappe zwei Jahre später. Auf einer vorbereitenden Tagung des DHM im Berliner Zeughaus Ende Oktober 2019 wurde durch Recherchen der Cambridger und Kölner Kunsthistoriker*Innen Bernhard Fulda und Julia Friedrich einer größeren Öffentlichkeit erstmals bekannt, dass Werner Haftmann, Arnold Bodes wichtigster Mitarbeiter bei der Schau, von 1937 bis 1945 Mitglied der NSDAP gewesen war. Eine große öffentliche Debatte war die Folge.
Seitdem wächst die Neugier über die Konzeption der Ausstellung. Für Gross ist die documenta deshalb interessant, weil man ihr in Fünfjahresschritten „die Chronologie einer politisch-ästhetischen Geschichte der Bundesrepublik erzählen“ könne. Diese Chronologie soll die Ausstellung entlang dreier Vektoren nachvollziehen: Dem Verhältnis der documenta zur NS-Zeit, zum Kalten Krieg und zur DDR und zum Westen. Dazu will Gross möglichst viele der Original-Kunst-Installationen der einzelnen documenta-Ausgaben „in Bezug setzen zu den Objekten des Museums, die die Zeitphänomene illustrieren, auf die sich die Kunst bezieht“.
Von dieser Gegenüberstellung verspricht sich der DHM-Direktor, der gerade auch die neue Dauerausstellung des DHM konzipiert, Aufschluss über die Frage, wie man mit Kunstwerken generell in einem historischen Museum umgeht. Zur Sammlung des DHM gehören nämlich auch sehr viele Kunstwerke. Natürlich versteht sich die Ausstellung in kritischer Absicht: Gross will „sehen, ob sich die Dinge, die man sich gern über die documenta ausdenkt und erzählt, mit dem übereinstimmen, was wir dann in den Archiven finden“.
Für dieses Vorgehen setzt der DHM-Direktor bei seinem Projekt nicht auf die sattsam bekannten Namen des internationalen Kuratoren-Karussells oder documenta-Insider. Mit der Zeithistorikerin Dorothee Wierling, der Kunst-Wissenschaftshistorikerin und ehemaligen FAZ-Kunstredakteurin Julia Voss und dem Autor, Kurator und Wissenschaftler Lars Bang Larsen hat er ein Kurator*Innen-Team verpflichtet, dessen Interdisziplinarität für neue Sichtweisen auf ein zum Mythos geronnenes Institut gut sein könnte.
Zeitlich wird die Ausstellung die Ausgaben der documenta 1 von 1955 bis zu Jan Hoets documenta 9 im Jahr 1992 umfassen. Mit der documenta selbst hat Gross vereinbart, dass das DHM das documenta-Archiv für seine Forschungen nutzen kann. Im Gegenzug sollen die Erkenntnisse, die seine Forscher sammeln oder die Oral-History-Interviews, die sie für die Ausstellung führen, später im documenta-Archiv in Kassel aufbewahrt bleiben.
Eine gewisse Brisanz birgt der Fakt, dass die Berliner Schau im Frühjahr 2021 und damit ein gutes Jahr vor der Eröffnung der documenta 15 eröffnen soll. Was immer sie zeigen wird, dürfte an der Kasseler Schau nicht spurlos vorübergehen. Weitere Funde zum NS-Komplex sind zumindest nicht auszuschließen.
Zeitgleich zur documenta-Schau will das DHM zudem eine Ausstellung zeigen, die sich mit der gut 1000 Namen umfassenden Liste der „Gottbegnadeten“ Künstler befasst. Darin ließen Hitler und Goebbels 1944 alle für Regime unverzichtbaren Kunstschaffenden zusammenfassen. Wie über allen Ausstellungs-Projekten derzeit schwebt auch über dem ambitionierten DHM-Projekt das Damoklesschwert Corona. Noch ist nicht abzusehen, ob die Pandemie eine Verschiebung oder Umplanung notwendig machen wird.



