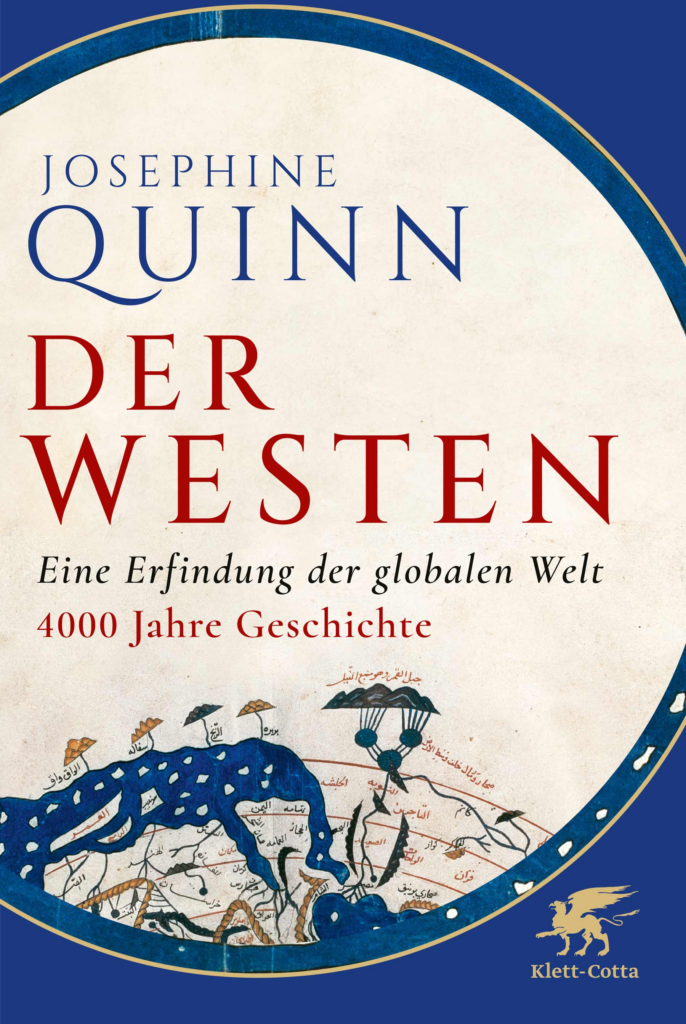
Der Aufstieg Chinas, der globale Rechtsruck und das Aufbegehren des Globalen Südens. Die geopolitischen Umwälzungen der letzten Jahre haben eine alte Debatte belebt, die der Politologe David Marwecki jüngst auf die Formel zuspitzte, sich auf eine „Welt nach dem Westen“ vorzubereiten.
Wenn die britische Historikerin Josephine Quinn in ihrem jüngsten Buch ebenfalls diese politische Hemisphäre aufruft, geht es ihr nicht um Globalstrategie. Die Cambridger Professorin für Alte Geschichte will diesen vermeintlichen zivilisatorischen Fixpunkt auf eine andere Art verabschieden.
Der Westen als Schimäre
Die Wissenschaftlerin hält die Idee eines einheitlichen Konstruktes „Westen“ für eine Schimäre. Für sie hat es, schreibt sie gleich zu Beginn, „nie eine einzigartige, reine, westliche oder europäische Kultur gegeben“. Ihr Buch versteht sie als späte, aber resolute Gegenthese zu der von dem US-Politologen Samuel P. Huntington 1996 ausgerufenen „Kampf der Kulturen“.
Zum Beweis ihrer These von Europa als einem politisch wie kulturell fragmentierten, widersprüchlichen, hemmungslos opportunistisch agierenden Hybrid, verfolgt sie dessen Werden von der levantinischen Metropole Byblos im Jahr 2000 v.u.Z. bis zum Aufbruch von Christoph Kolumbus in die Karibik Mitte des 15. Jahrhunderts.
Recht und Literatur, so Quinn, hätten die westlichen Länder aus Mesopotamien, Bildhauerei aus Ägypten, das Alphabet aus der Levante übernommen. Selbst proto-demokratische Regierungsformen existierten mit einem Ältestenrat und einer Volksversammlung bereits Jahrhunderte vor Athen und Sparta in einer Kolonie assyrischer Händler in Anatolien.
Quinn gelingt es unakademisch und mit stupender Detailkenntnis, die eurozentrische Geschichtsperspektive in eine universale zu weiten. Geschichte wird bei ihr zu einem Prozess sich ständig neu gruppierender, (Fernhandels-)Netzwerke. Die europäischen Länder lagen Jahrhunderte lang bloß an deren Peripherie.
Ihr Werk ist zudem eine Fundgrube faszinierender historischer Exkurse zum Einsatz von Elefanten als Kriegswaffe über die Erfindung des Schachs bis zum gescheiterten Mieten-Deckel von Gaius Julius Caesar.
Ethnische Säuberung und imperiale Eroberung
Der Grundwiderspruch ihrer eloquenten historiographischen Dekonstruktion ist freilich, dass Quinn zwar die Idee abgegrenzter Kulturen ablehnt. Dann aber die Einflüsse, die die unter dem Begriff „Westen“ subsumierten Länder adaptieren, „Kulturen“ zuordnet.
Die Beweiskraft ihrer anti-kulturalistischen These schmälert zudem, dass sie die 500 Jahre Geschichte des „Westens“ seit Kolumbus nicht verfolgt. So entsteht der verkürzte Eindruck einer ungebrochenen Konstante „aus ethnischer Säuberung und imperialer Eroberung“ sowie einer „gemeinsamen christlichen Identität“, wie sie sich seit der Mitte des 14. Jahrhunderts in Westeuropa herausbildete.
Einen Vorteil hat Quinns produktiver Perspektivwechsel und das Lob der „kulturellen Entlehnungen“ dennoch: Wenn es „den Westen“ gar nicht gibt, dann sind die Unkenrufe über sein bevorstehendes Ende gegenstandslos. Denn ein Phantom kann selbst Donald Trump nicht auf den Misthaufen der Geschichte befördern.
Josephine Quinn: Der Westen. Eine Erfindung der globalen Welt. 4000 Jahre Geschichte. Übersetzt aus dem Englischen von Norbert Juraschitz und Andreas Thomsen. Klett-Cotta, Stuttgart 2025, 684 S., 38 Euro
