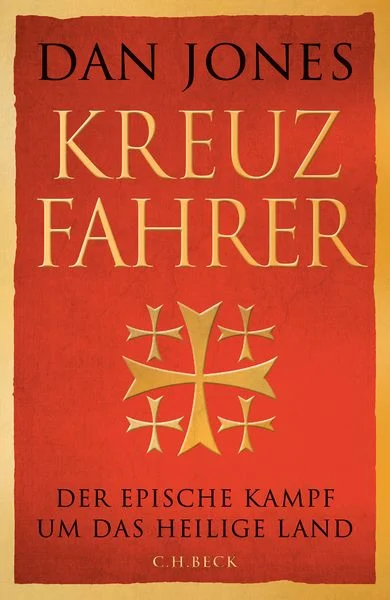
Ein „Kreuzzug gegen die liberale Demokratie“. Der Begriff, mit dem vor drei Jahren Bundeskanzler Olaf Scholz den Angriff Russlands auf die Ukraine belegte, ist für Dan Jones nicht viel mehr als eine Metapher. In seinem jüngsten Buch geht es dem britischen Historiker und Schriftsteller um die realen, blutigen Glaubensschlachten des Mittelalters.
Jones ist kein Geschichtswissenschaftler, sondern ein – im besten Sinne – Geschichts-Erzähler. Der Autor zahlreicher historischer Bestseller und TV-Dokumentationen, liefert keine völlige Neuinterpretation der Kreuzzüge, sondern schlägt sich auf die Seite ihrer „pluralistischen“ Interpretation.
Er lässt ihre 1099, mit der Eroberung Jerusalems beginnende, Geschichte nicht mit der Niederlage des letzten Kreuzfahrerstaates in Akkon 1291 gegen den Mamluken-Sultan Chalil enden. Sondern mit der Kapitulation Granadas 1492, als Ferdinand und Isabella von Kastilien die Reconquista beendeten. Jones zählt die weniger beachteten Kreuzzüge im Baltikum und Nordafrika hinzu. Selbst in Columbus’ Entdeckung Amerikas sieht er deren spätes Echo.
Sein Buch hat Jones nicht umsonst „Kreuzfahrer“ genannt. Er will Geschichte nicht abstrakt erzählen, sondern vermittels konkreter Menschen. Protagonisten wie der Kreuzfahrer Richard Löwenherz oder Sultan Saladin werden bei Jones gleichsam lebendig. Bei manchen Schlachten wähnt man sich direkt im Geschehen. Mit Königin Melisende von Jerusalem oder der Pilgerin Margaret von Beverly beleuchtet er die Rolle von Frauen in den Feldzügen.
Kirchlich gebilligter Militarismus
Trotz der Fixierung auf das Personal, arbeitet Jones Strukturelles heraus: Die Kreuzzüge als neue Art von Krieg des „kirchlich gebilligten Militarismus“. Er zeigt das spätere Erlöschen des ideologischen Impulses, für den prototypisch der Überfall Venedigs 1204 auf Konstantinopel während des Vierten Kreuzzuges steht.
Akribisch zeichnet er nach, wie bei den diversen Kreuzfahrerstaaten im Heiligen Land die Machtinteressen der rasch wechselnden Dynastien die Oberhand gewannen und die fragilen Staaten auszehrten. Durch das Aufkommen der Nationalstaaten und die Reformation, so argumentiert Jones schließlich überzeugend, zerfiel die religiöse Sammlungsidee der Kreuzzüge im Laufe weniger Jahrhunderte zu einem „vagen Projekt“.
Jones Buch ist ein herausragendes Beispiel der angelsächsischen Non-Fiction-Tradition. Glänzend verbindet er „Wissensvermittlung und Entertainment“ – sein Credo – in einem süffigen Pageturner ohne akademische oder rhetorische Schlacken. Er erzählt packend, gelegentlich flapsig, bleibt historisch aber immer präzise. Den sakralen Mythos Kreuzzug und Kreuzfahrer zerlegt Jones gründlich.
Blutzoll des Krieges
Mit seinem versierten Storytelling macht der Autor die ideologische Konsequenz, die martialische Wucht und die barbarische Grausamkeit der Kreuzzüge im Speziellen anschaulich. Indirekt ist sein Werk so eine Warnung vor dem Blutzoll jedes Krieges.
Das historische Desaster der Kreuzzüge ändert aber nichts an deren Strahlkraft. Der norwegische Massenmörder Anders Behring Breivik sah sich als Parteigänger des Templerordens, einem der militarisierten Mönchsorden, die während der Kreuzzüge entstanden.
Jones nennt ihn deshalb nicht ganz zu Unrecht einen „Kreuzfahrer des 21. Jahrhunderts“. Auch wenn er nur einen Ein-Mann-Kreuzzug (an-)führte, fielen ihm 2011 in Oslo und Utøya 77 Menschen zum Opfer.
Dan Jones: Kreuzfahrer. Der epische Kampf um das Heilige Land. Aus dem Englischen von Heike Schlatterer und Karin Schuler. C.H.Beck, München 2025, 544 Seiten, 36 Euro
